Psychoanalyse lesbischer Sexualität (Rezension)
Rezension: Manuela Torelli, Psychoanalyse lesbischer Sexualität von Christina Bauer und Dipl.-Psych. Antje Doll
Bibliothek der Psychoanalyse, Psychosozial-Verlag, Gießen 2008, ISBN 987-3-89806-762-1, 39,90 €
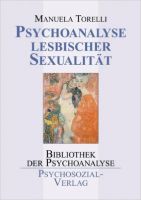
Das Buch ist die Veröffentlichung der Dissertation der Autorin und folgt daher im Aufbau gewissen Prinzipien, die die Lesbarkeit erschwert. Es richtet sich vorwiegend an ein Fachpublikum. Gegliedert ist es in einen allgemeinen Theorieteil, die Darstellung der empirischen Arbeit, Auswertung und ein Kapitel, das sich der speziellen neuen Theoriebildung widmet.
Der allgemeine Theorieteil bringt eine gute Zusammenfassung bisheriger psychoanalytischer Literatur. Es wirkt aufbereitet und flüssig geschrieben. Allerdings benennt Torelli nicht, in wie weit sie sich der Triebtheorie, der Objekttheorie oder der Bindungstheorie verbunden fühlt. Sie nutzt die jeweiligen Theoriebausteine losgelöst von ihrem jeweiligen geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext für eigene Interpretationen und theoretische Implikationen. Dies macht den Anschein, dass die Torelli’sche Arbeitshypothese wiederholt gut belegt erscheint. Torelli untermauert ihre Argumentation mit dem Konzept des Todestriebs von Freud (1920), unabhängig davon, dass Freud selbst seine These später explizit zurück genommen hat (S. 154ff).
Sie schlägt auch Brücken zur Entwicklung in der Frauenbewegung und deren Theoriebildungen. Warum aber ein spezifischer Teil dieser Entwicklung, nämlich die Kritik und Abkehr vom weiblichen Exhibitionismus und des „Weibchen-Seins” im Zusammenhang mit der Patriarchatskritik der Frauenbewegung zu einem generalisierten Vorwurf der „Entwertungen des Weiblichen im Feminismus” vergröbert und als eigenes Unterkapitel eingeführt wird, ist unklar.
Auch ist dieser Untersuchung ein grober Mangel an sozialwissenschaftlicher Methodik vorzuwerfen. Selbst wenn es sich um eine qualitative Analyse handelt, die keinerlei Repräsentanz ob der Stichprobe bedarf, ist die Auswahl zu bemängeln. Es ist evident, dass es telefonisch geführten qualitativen Interviews an Authentizität mangelt. Eine wirkliche Beziehung zwischen Fremden kann am Telefon nicht hergestellt werden. Wesentliche Aspekte wie Mimik, Gestik, Schwingungen in der Stimme, gemeinsames Schweigen, Atmosphärisches im Raum, die Verstehen und Verständnis erst ermöglichen, fallen weg. Wir fragen uns hier, wie Torelli ernsthaft meint, dieses „hochartifizielle” Material psychoanalytisch auswerten zu können. Weiterhin methodisch unsauber ist die Verkürzung der Auswahl von 22 auf 4 Probantinnen. Jene vier erfüllen die stillschweigend implizierten wesentlichen Arbeitshypothesen der Autorin. Hat z.B. Poluda-Korte ihre Theorie des lesbischen Komplexes zwar anhand weniger Fälle, aber in jahrelanger intensiver Zusammenarbeit und Reflektion formuliert, so genügen Torelli hierfür Einzelinterviews von ca. 1 Stunde.
Dennoch sind einige Thesen der Autorin bedenkenswert und wichtig. Besonders ihr kritischer Blick darauf, dass die Überbetonung sexueller Übergriffe tiefer liegende Entwicklungshemmungen verdecken kann, ist für die psychotherapeutische Praxis hilfreich.
Wir teilen allerdings nicht ihre Annahme, dass das Coming-Out immer unter dem Triebdruck der Adoleszenz stünde. Dies entspricht nicht der Wirklichkeit von Frauen, die ihr Coming-Out mit 11-12 haben, andere mit 17, wieder andere mit 30, 40, 50, 60 oder 70 oder mittendrin!
Idealisierend erscheint die Beschreibung der Lesbenszene S. 153: Die Lesbenszene ermöglicht nicht per se, einen lesbischen Lebensstil zu entwickeln. Sie wird auch als hemmend, ängstigend und beschränkend erlebt. Kneipenbesuche fördern nicht unbedingt ein seelisch angenehmes Coming-Out. Viele Frauen heute suchen eher im Internet in bestimmten ausgesuchten Foren ihr Glück als in der Kneipe. Zudem: Frauen haben sich in vielen Epochen und Kulturen lesbisch entwickelt. Die Homophobie wie die internalisierte Homophobie entspringen unterschiedlichsten Quellen und machen das Coming-Out so schwer.
Torelli bietet durchaus kritische historische Ansätze an. Dass der §175 in der Bundesrepublik erst 1994 – in Angleichung an DDR-Recht- aufgehoben wurde, dürfte in diesem Zusammenhängen aber gern mit Jahresangabe erscheinen, da gerade dies Rückschlüsse auf den historischen Kontext zulässt. (S.148, 7.2.)
Wir fragen uns, wieso die Autorin meint behaupten zu können, dass lesbischer und schwuler Sexualität bis heute ein Penetrationswunsch abgesprochen wird (S.148, 7.2.). Uns erscheint das fern lesbisch-schwuler Wirklichkeit; ein Blick in entsprechende Anzeigen und Blättchen genügt da: diese scheinen vor Dildos und erigierten Penissen eher an einer Penetrationslast zu ersticken.
Unspezifisch für lesbische Paarbeziehungen erscheint uns jene Aussage: „Auch ohne Kinder kann ein lesbisches Leben gemeinsam gelingen. Allerdings muss die Aufgabe, die eine länger dauernde Beziehung zusammenhält, ihr Sinn gibt und immer wieder produktive Spannungen erzeugt, auf anderen – unkonventionellen und kreativen Wegen – entdeckt und durchgehalten werden.” Dies erleben Menschen in jeder Paarbeziehung, wenn sie sich nicht über gemeinsame Kinder sondern über ein anderes gemeinsames „Drittes” binden. Wesentlich scheint uns hier doch die Entwicklung liebevoller Verantwortung füreinander und für das gemeinsame Dritte zu sein. Wir denken, dass Liebe und Verantwortungsgefühl binden. Kinder können binden, wenn Liebe und Verantwortungsgefühl da sind und im guten Sinne getragen werden können. Aber Kinder müssen nicht binden. Wie viele Kinder werden gezeugt, obwohl ein Paar schon innerlich getrennt ist und sich über das gemeinsame Dritte eine Wiederannäherung und Wiederbelebung der Liebe erhofft, was dann nicht gelingt.
Die Achillesferse des Buches ist also der Umgang der Autorin mit dem Thema der Generativität. Torelli führt ihre These der Generativität als selbstverständliches Postulat ein, ohne diese näher zu begründen oder als nachzuweisende Arbeits-Hypothese darzustellen. Zitat: „Homosexuelle gehören einer Minderheit an, die dem unverrückbaren Umstand ins Auge sehen muss, dass nicht die gleichgeschlechtlichen, sondern die gegengeschlechtlichen Genitalien aus biologisch-anatomischer Sicht aufeinander abgestimmt sind und damit Generativität bei Homosexuellen nicht gegeben ist.” S. 151. Die aus der Sicht der Autorin offenbar leidvolle Erfahrung, als Frau nicht (ohne weiteres) mit einer anderen Frau ein Kind zeugen zu können, bezeichnet die Autorin sogar als „zentrales Trauma (!) homosexueller Entwicklung” und kommt immer wieder, in fast jedem Kapitel darauf zurück. Dieses Postulat erstaunt dann doch. Ist die homosexuelle/ lesbische Entwicklung also doch per se pathologisch, weil traumatisch? Da möchte man fragen, was denn das zentrale Trauma der heterosexuellen Entwicklung wohl sei? Ist die Psychoanalyse ja sehr erfahren in der Symbolisierung, ist es umso erstaunlicher, dass gerade bei diesem Thema die Autorin ganz platt biologisch und damit biologistisch bleibt. Über den gleichen Kamm geschoren werden auch noch heterosexuelle Frauen ohne Kinderwunsch. Die Bedeutung weiblicher Kreativität an sich in der möglichen Vielfalt und als kreativer Prozess wird nicht aufgenommen. Ebenso wenig die Tatsache, dass Frauen lange einem Zwang zur Generativität unterlagen, der andere weibliche Kreativität erschwerte oder oft ganz unmöglich machte (z.B. Paula Modersohn-Becker). Unter den Tisch fallen die kreativen Leistungen von Frauenpaaren (z.B. Gertraude Stein und Alice B. Tooklas, Ruth Benedict und Margret Mead).
Bei genauerer Lektüre wirkt es zunehmend anmaßend, dass sie wiederholt und an keiner Stelle eine nachvollziehbare Herleitung ihrer Generativität-These anbietet. Mit der Überbetonung von Generativität rutscht Torelli hier – vielleicht unbewusst – an die Grenze biologistisch-fundamentalistischer, patriachaler Theoriebildung. Die Frauenbewegung und mit ihr Simone de Beauvoir feierte Ende der 70er Jahre nicht von ungefähr auch die sexuelle Befreiung und sexuelle Emanzipation der Frauen: erst durch die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung können gebärfähige Frauen sich entscheiden, ob sie sich biologisch fortpflanzen wollen oder ob nicht. Sicherlich leiden Frauen, wenn sie ihren Wunsch, schwanger zu werden und ein Kind in die Welt zu gebären nicht umsetzen können. Das dürfte heute Lesben wie Heteras betreffen. Aber es gibt auch Frauen, die nicht darunter leiden. Es gibt Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, die nicht unter dem Mangel an Kinderwunsch leiden und sich bewusst andere Formen von Generativität suchen. Der von Torelli gern zitierte Kernberg untermauert ihre These der Generativität gerade nicht! Er schreibt: „Sexuelle Leidenschaft tritt auch darin zutage, dass man ein subtiles, aber tiefgründiges, sich selbst genügendes und selbstkritisches Bewusstsein von der eigenen Liebe zu einem anderen Menschen hat, während man sich völlig im Klaren darüber ist, dass Menschen füreinander letztlich ein Geheimnis und somit getrennt voneinander bleiben, und akzeptiert, dass unerfüllbare Sehnsüchte der Preis sind, den man zu zahlen hat, wenn man sich ganz an einen geliebten Anderen bindet”. (Kernberg 1998, S. 71). Und wie kommt Torelli dazu, zu behaupten, dass der Kinderwunsch für Lesben eine größere Bedeutung habe als für Schwule? Dies ist ebenfalls eine nicht belegte Annahme, keine bewiesene Tatsache. Gerade wenn man sich dem Thema Kinderwunsch tiefenpsychologisch oder analytisch nähert, können wir hier keinen Unterschied zwischen weiblichem und männlichem Wünschen ob der eigenen Generativität finden und erinnern den selten aber auch gern mal postulierten Gebärneid.
Das vorliegende Buch kann also nur eingeschränkt empfohlen werden. Für entsprechend vorgebildete LeserInnen bietet es einen sinnvollen Diskussionsbeitrag zu einzelnen Fragen der lesbischen Sexualität. Eine Psychoanalyse Lesbischer Sexualität bietet es nicht. Hier ist der Titel viel zu hoch gegriffen. Die Chance, die Psychoanalyse als sinnvolle Methode und Erkenntnismöglichkeit bei lesbischen Frauen und der Frauenbewegung zu rehabilitieren, hat die Autorin bedauerlicherweise nicht nutzen können.
Christina Bauer
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kiel
Dipl.-Psych. Antje Doll
Psychologische Psychotherapeutin, Preetz